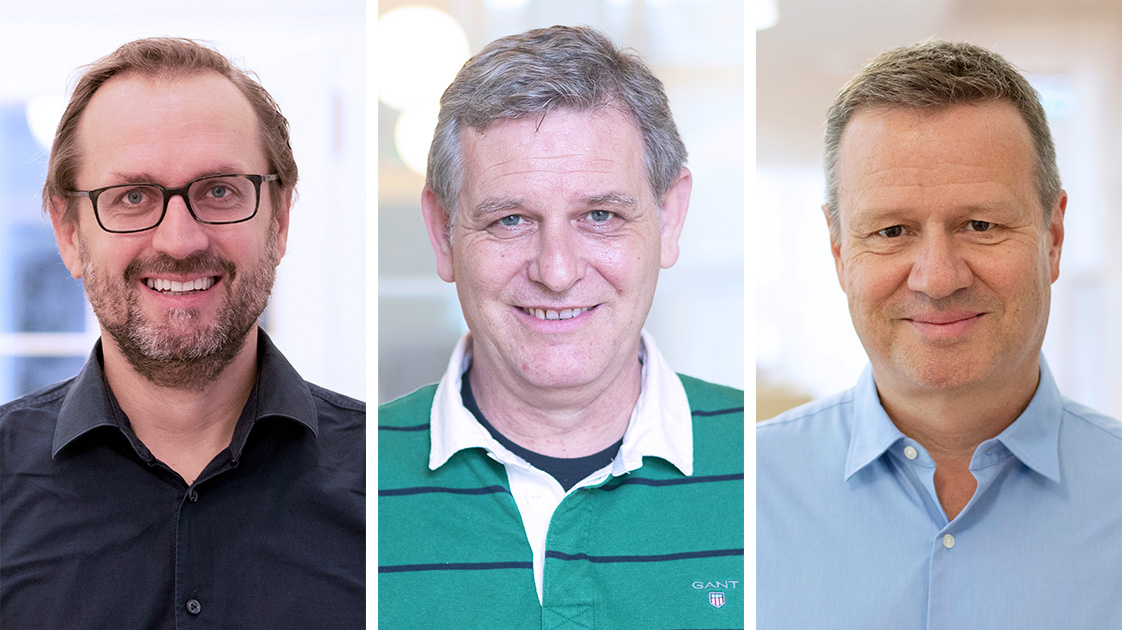Kenneth Dürsteler und Hannes Strasser, Sie waren als junge Ärzte bei den Anfängen der HeGeBe dabei. Sie, Kenneth Dürsteler, haben als Student auf dem Zürcher Platzspitz den Drogensüchtigen geholfen. Und Sie, Hannes Strasser, haben mit Janus in Basel viel Pionierarbeit geleistet. Heute leiten Sie das Suchtambulatorium (SAM) der UPK Basel. Es hat sich vieles zum Guten getan, was muss sich verbessern?
Kenneth Dürsteler: Im Bereich der Früherkennung und Frühintervention besteht noch erheblicher Entwicklungsbedarf. Frühzeitige Therapieangebote können oft den Verlauf von Substanzkonsumstörungen und zusätzlich bestehender psychischer Störungen günstig beeinflussen und einer Chronifizierung entgegenwirken. Auch in der Ausbildung gibt es nach wie vor grosse Defizite. Zu den wirksamsten Behandlungsansätzen vieler Substanzkonsumstörungen zählen spezifische psychotherapeutische Verfahren, die in den Psychotherapie-Weiterbildungen leider häufig nicht vertieft vermittelt werden.
Hannes Strasser: Bei unserem Angebot der Opioid-Agonistentherapie und Heroingestützten Behandlung verfügen wir heute über hervorragende Bedingungen. Das erlaubt uns, die Behandlung fortlaufend weiter zu entwickeln und den Patientinnen und Patienten eine breitgefächerte, qualitativ hochstehende, individuelle Behandlung anzubieten. Ein vergleichbares Angebot möchten wir auch für andere Substanzkonsumstörungen aufbauen, insbesondere für den Konsum von Alkohol, Kokain und Cannabis, vielleicht auch Tabak. Der Bedarf an Behandlungsplätzen in unserer Region besteht, und wir bringen die Expertise mit.
Vor dreissig Jahren gingen Bilder vom Elend in Zürich um die Welt. Und heute ist die Schweiz mit ihrer liberalen Drogenpolitik international ein Vorbild. Was hat sich zum Guten getan?
Marc Vogel: Es ist richtig, dass die Schweizer Drogenpolitik mit dem Vier-Säulen-Modell (Prävention –Therapie –Repression – Schadensminderung) als vorbildlich gilt. Die niederschwelligen Angebote wie Kontakt- und Anlaufstellen, Opioidsubstitution oder heroingestützte Behandlung haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die offenen Drogenszenen der 90er Jahre weitgehend verschwunden sind. Auf der anderen Seite herrscht in der Drogenpolitik jedoch seit Jahren Stillstand, wenn es um die Prävention der Tabakabhängigkeit oder eine gesellschaftliche Reduktion des Alkoholkonsums geht. Auch in der Cannabispolitik bewegt sich die Schweiz nur langsam und wird von der Realität wie auch den Nachbarländern überholt. Wir können uns also keineswegs auf den Lorbeeren der 90er Jahre ausruhen.
Hannes Strasser: Der politische und erfrischende Pragmatismus der 90er-Jahre ist etwas verloren gegangen. Die Stärke des damals geschaffenen Vier-Säulen-Modells lag in der neu propagierten Schadensminderung, die als wichtiges Interventionsprinzip übernommen wurde. Dadurch ergaben sich neue pragmatische und effiziente Behandlungsmöglichkeiten, die in herkömmlichen therapeutischen Settings undenkbar waren.
Was läuft auf politischer Ebene falsch?
Hannes Strasser: Heute herrscht zu meinem Bedauern eine gewisse justizielle Nüchternheit. Viele Interventionen sind hochgradig reglementiert und werden ständig auf Gesetzeskonformität hin überprüft. Leider fehlt manchmal die Weitsicht, nicht nur Behandlungsbedingungen, sondern auch Gesetzesbedingungen überdenken zu müssen. Jüngstes Beispiel ist die Revision der Betäubungsmittelsuchtverordnung, bei der sich die verantwortlichen Gesetzesvertreter wenig verantwortungsvoll und mutlos präsentierten.
Kenneth Dürsteler: Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für individuelle Therapieerfolge ist es wichtig, Menschen mit Substanzkonsumstörungen bestmöglich in die Gesellschaft zu integrieren. Dies wird nur mit einem Umgang ohne Stigmatisierung der Betroffenen gelingen. Dazu gehören zum Beispiel eine wertschätzende vorurteilsfreie Begegnung, die Einbindung in die Regelversorgung sowie ein funktionales Krankheitskonzept von Substanzkonsumstörungen.
Über Drogen herrscht seit Jahrzehnten Uneinigkeit, es gibt viele Vorurteile gegenüber süchtigen Menschen. Ist der Süchtige nun selber an seiner Sucht schuld, die Gesellschaft – oder ist alles einfach erblich bedingt und somit vorbestimmt?
Marc Vogel: Weder das eine, noch das andere ist alleine ursächlich. Es ist richtig, dass die Erbanlagen ungefähr die Hälfte des Risikos ausmachen. Es kommen aber immer mehrere Faktoren bei der Entstehung einer Abhängigkeitserkrankung zusammen. So können zum Beispiel schwierige Bedingungen in der Kindheit, traumatische Erlebnisse, psychische Erkrankungen oder die gesundheitspolitischen Regelungen im Umgang mit psychoaktiven Substanzen das Risiko beeinflussen. Die persönlichen Entscheidungen zum Konsum sind nur ein Faktor unter vielen.
Also sind suchtkranke Menschen «nicht selber schuld»?
Marc Vogel: Die Frage nach Schuld ist letztendlich nicht hilfreich. Die meisten suchterkrankten Menschen werden ohnehin von Schuldgefühlen geplagt, die nicht zuletzt zu einer verzögerten Inanspruchnahme von Hilfe und einer Tabuisierung der Erkrankung beitragen.
Anfang des 20. Jahrhunderts führte der damalige ärztliche Direktor des Burghölzlis (Psychiatrie in Zürich) die Sterilisation auch an Alkoholikern durch. Welches sind für Sie die schlimmsten Vorurteile, denen Drogenabhängige heute ausgesetzt sind?
Hannes Strasser: Vorurteile gegenüber Drogenabhängigen waren schon immer durch moralische Vorstellungen, persönliche Meinungen und manchmal auch durch absurde Reglemente und Gesetze geprägt, die diese Vorurteile widerspiegeln. Entsprechend bedenklich scheint mir heute weiterhin die gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund der Andersartigkeit einiger Drogenabhängiger zu sein. Diese Ausgrenzung ergibt sich nicht durch den Drogenkonsum selber, sondern durch die von der Gesellschaft vorgegebenen Bedingungen oder eben durch Vorurteile.
Nicht nur in Bezug auf Sicht auf Drogen und Süchtige hat sich viel gewandelt, sondern auch punkto Substanzen. Welche grössten Gefahren sehen Sie diesbezüglich als erfahrene Suchtmediziner auf unsere Gesellschaft zukommen?
Marc Vogel: Die Welt der Drogen ist im Fluss, ständig werden neue Substanzen entwickelt. Der Gesetzgeber kommt mit dem Verbieten nicht nach. Angesichts des zunehmenden Konsums von Kokain oder anhaltend hoher Zahlen von Cannabiskonsum muss man ohnehin hinterfragen, ob Substanzverbote der beste Weg sind. Gleichzeitig haben wir legale Substanzen wie Nikotin, deren Konsum gerade bei Jugendlichen wieder ansteigt…
… wer bezahlt die Zeche?
Marc Vogel: Gesamtgesellschaftlich gesehen wird bei den Jugendlichen der grösste Schaden entstehen, weil die Betroffenen oft ihr Leben lang abhängig sein und häufig an den Folgeschäden versterben werden. Eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik muss hier mit Werbeverboten und einfachen, aber wirksamen Massnahmen wie «Plain Packaging»** aktiv werden. Weiterhin erwarten wir grosse Herausforderungen im Umgang mit der Opioidabhängigkeit angesichts der in Europa steigenden Funde von hochpotenten Opioiden wie Nitazenen oder Fentanyl. Ohne konsequente Gegenmassnahmen im Bereich der Schadensminderung und Therapie besteht eine grosse Gefahr, dass die Zahl der Drogentoten wieder ansteigt.
Hannes Strasser: Die grössten Gefahren gehen nicht von den Substanzen selber aus. Es ist erschreckend, wie riskant und unwissend Menschen mit dem Konsum oder dem Mischen von Substanzen umgehen. Entsprechend erscheinen mir Aufklärung und Wissensvermittlung, Konsumkompetenz und «Safer-Use-Regeln», also gut durchdachte Vorkehrungen für einen risikominimierten Drogenkonsum, immer besser geeignet als tabuisierende, verbietende, bestrafende und politisch motivierte Regulierungen. Der Drogenpolitik kommt deshalb auch in Zukunft eine hohe Bedeutung zu. Die Vergangenheit hat eindrücklich aufgezeigt, dass sich eine Orientierung an liberalen und pragmatischen Werten lohnt.
Kenneth Dürsteler: Substanzkonsumstörungen gehören zu den vierthäufigsten psychischen Krankheitsbildern und verursachen enormes Leid für die Betroffenen und ihr Umfeld. Unbehandelt haben sie eine hohe Mortalität. Leider spiegelt sich dies nicht in der Forschungsförderung wider. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen fristen Substanzkonsumstörungen bei der Vergabe von Fördergeldern leider immer noch ein stiefmüttercherliches Dasein.
*PD Dr. Marc Vogel, Dr. Kenneth Dürsteler und Dr. Hannes Strasser sind ausgewiesene und erfahrene Suchtexperten der UPK Basel. Marc Vogel ist Chefarzt am Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen (ZAE), Kenneth Dürsteler und Hannes Strasser leiten zusammen mit Daniel Scheidegger das Suchtambulatorium SAM.
**Unter «Plain Packaging» ist das Konzept der Verwendung von neutralen und einheitlichen Verpackungen für Tabakprodukte zu verstehen, es wird in einigen Ländern bereits umgesetzt.
Das Progamm zur Frühjahrestagung erfahren Sie hier.